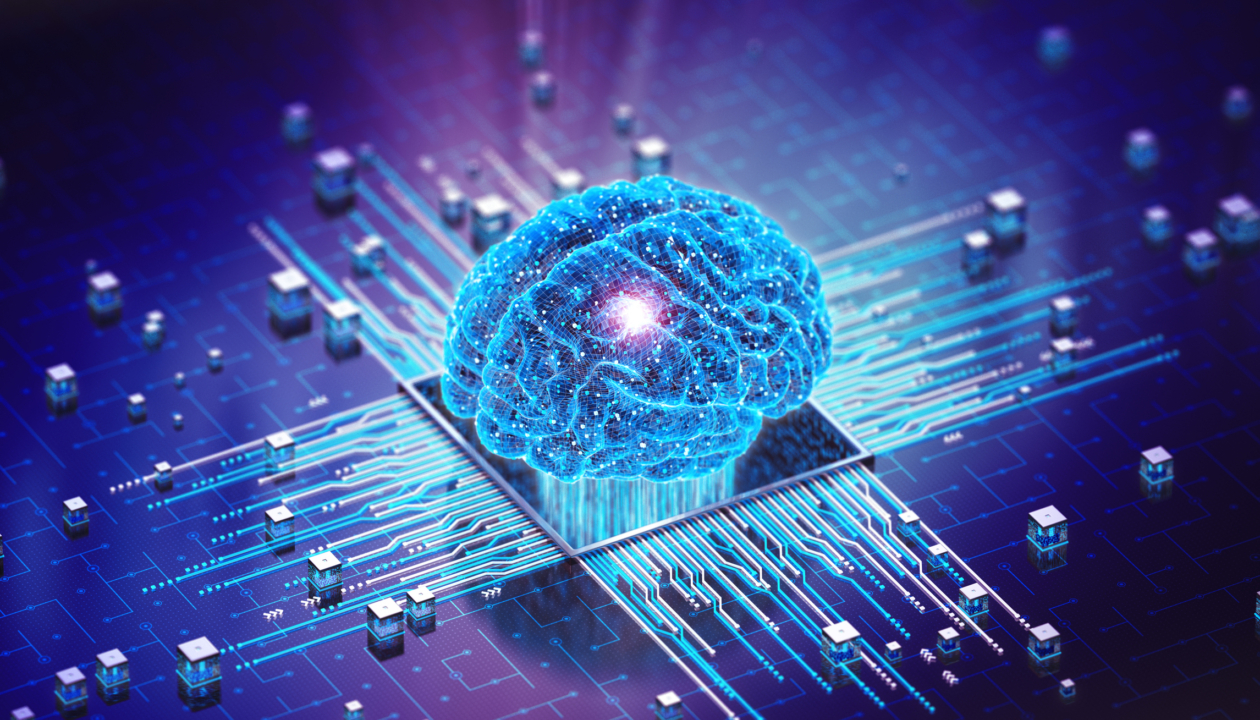PRO
Das Urheberrecht bremst Fortschritt.
Max Schlensag, Gründer und Geschäftsführer Futurised GmbH

Ja, zu diesen Zwecken sollte das Urheberrecht unbedingt gelockert werden. Europa droht, im globalen KI-Wettlauf weiter zurückzufallen – nicht, weil es an Talenten mangelt, sondern an Zugang zu Daten. Während in den USA und China KI-Modelle längst auf umfassende Inhalte trainiert werden, stößt man hierzulande oft an rechtliche Grenzen, bevor überhaupt Innovation entstehen kann. Das aktuelle Urheberrecht war nicht für eine Ära gedacht, in der Daten der entscheidende Rohstoff sind.
Es bremst Fortschritt – und damit letztlich uns alle. Dabei geht es nicht um das Abschaffen von Rechten, sondern um deren zeitgemäße Neugestaltung. Eine gezielte Lockerung mit klar definierten Rahmenbedingungen – etwa für wissenschaftliche, unternehmerische oder gesellschaftlich relevante Zwecke – würde es ermöglichen, KI-Modelle auf realitätsnahe Inhalte zu trainieren. Das Ergebnis: bessere Sprachmodelle, leistungsfähigere Automatisierungen und eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.
Wer Innovationsstandorte wie Deutschland stärken will, darf nicht zulassen, dass Künstliche Intelligenz nur in der Theorie existiert. Heute dürfen wir erforschen – aber kaum anwenden. Gerade in mittelständischen Betrieben oder bei der Automatisierung von Verwaltungsprozessen fehlt es an rechtlicher Klarheit und praxisnahen Möglichkeiten. Das hemmt Wachstum, Investitionen und Technologietransfer. Ohne Zugang zu realen Inhalten bleibt Künstliche Intelligenz künstlich begrenzt. Wer ernsthaft digitale Souveränität will, muss auch den Mut aufbringen, rechtliche Rahmen so zu gestalten, dass Fortschritt möglich ist: verantwortungsvoll, aber entschlossen.
KONTRA
Kreative Leistungen würden entwertet.
Isabel Jansen, Leitung Beratung und Weiterbildung Hamburg Kreativ Gesellschaft

Die Kreativwirtschaft lebt von Ideen – und davon, dass diese rechtlich geschützt sind. Das Urheberrecht ist das Fundament für die wirtschaftliche und kulturelle Existenz von Autor:innen, Musiker:innen, Designer:innen und vielen anderen Kreativen. Eine Lockerung zugunsten von KI-Trainingsdaten würde dieses Fundament untergraben. Kreative Leistungen würden entwertet, geistiges Eigentum zum kostenlosen Rohstoff für Dritte – ohne Zustimmung und faire Gegenleistung.
Natürlich muss sich die Kreativbranche den technologischen Entwicklungen stellen, um zukunftsfähig zu bleiben. Innovation ist willkommen, doch nicht auf Kosten derer, die die kreativen Grundlagen schaffen.
Genau deshalb müssen die Risiken für Urheberrechte klar benannt werden. Generative KI-Modelle werden oft mit urheberrechtlich geschützten Texten, Bildern oder Musikstücken trainiert. Die Wertschöpfung verschiebt sich dabei weg von den Schöpfer:innen hin zu Technologieunternehmen, die auf diesen Werken aufbauen.
Aktuelle juristische Verfahren – etwa von Verwertungsgesellschaften wie der GEMA – zeigen, dass hier ein grundlegendes Gerechtigkeitsproblem besteht. Statt Rechte zu schwächen, braucht es Lizenzmodelle, die KI-Training auf gemeinfreien, freiwillig freigegebenen oder gezielt lizenzierten Inhalten ermöglichen. Der Aufbau einer starken europäischen KI-Infrastruktur muss kreative Rechte respektieren, nicht umgehen.
Denn nur wenn Urheberrechte auch im digitalen Zeitalter verlässlich gelten, können Kreative ihre Arbeit nachhaltig finanzieren. Geschützt wird damit nicht allein ein Berufsstand, sondern die kulturelle Vielfalt einer Gesellschaft. Wer heute das Urheberrecht relativiert, riskiert, dass morgen Qualität, Diversität und Innovationskraft unserer Kreativwirtschaft verloren gehen.
Auch KI-generierte Inhalte, darunter Texte, Musikstücke und Bilder, unterliegen dem europäischen Urheberrecht. Urheberrechtsschutz besteht allerdings nur dann, wenn an deren Gestaltung maßgeblich ein Mensch beteiligt ist. Reine KI-Schöpfungen hingegen sind nicht geschützt. Geschützte Inhalte dürfen für das Training von KI bislang nur verwendet werden, sofern der Urheber oder die Urheberin dies auch ausdrücklich erlaubt. Die Nutzung geschützter Werke ohne Zustimmung kann rechtliche Folgen haben. Ab 2026 wird die EU das Urheberrecht im Zusammenhang mit KI überprüfen. Wer KI-Tools anbietet, muss zudem Transparenz über verwendete Trainingsdaten sicherstellen.