
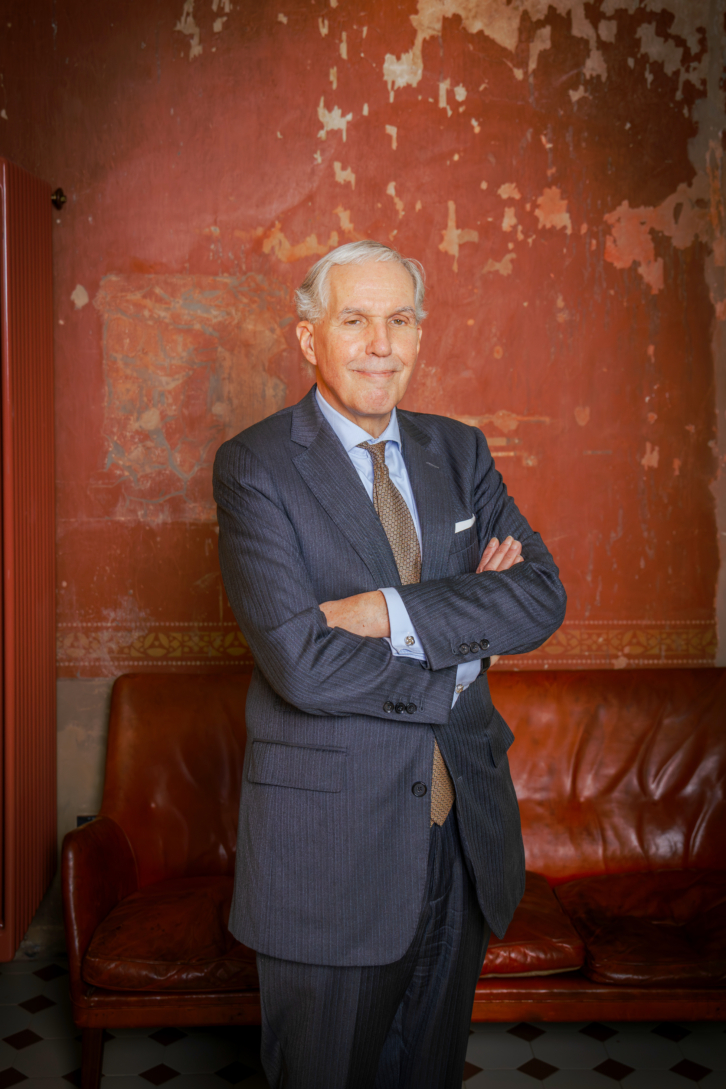
Herr Prof. Schwenker, Sie gelten privat und beruflich als Optimist. Ist das Glas bei Ihnen immer halb voll oder auch mal halb leer?
Prof. Burkhard Schwenker: Es gibt natürlich auch bei mir halb leere Gläser, aber ich versuche, mich stets an ein Zitat von Winston Churchill zu erinnern: Ein Pessimist sieht in jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit, ein Optimist in jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit.
Welcher Burkhard Schwenker hat Ihren Leitsatz „Optimismus zählt“ da denn nachhaltiger geprägt: der Mathematiker, der Manager, der Familienvater, der Aufsichtsrat?
Alle ungefähr gleich, aber ein Stück weit ist er auch anerzogen. Die Geisteshaltung in meinem Elternhaus war grundsätzlich hoffnungsfroh. Als Sohn eines Tischlers in einem winzigen Dorf mit dem lebensbejahenden Namen Totenhausen wurde über so etwas zwar wenig gesprochen. Aus der Erfahrung eines überstandenen Weltkrieges heraus aber, gepaart mit ländlicher Gelassenheit, war die optimistische Einstellung jederzeit spürbar.
Diese Gelassenheit ist in Hamburg gerade nicht zu spüren, wie das Konjunkturbarometer der Handelskammer zeigt. Pessimismus überwiegt.
Und das deckt sich mit Konjunkturbarometern anderer Städte und Länder. Gerade hier ist dieser Pessimismus aber auch Einstellungssache. Anders als die deutsche Gesamtwirtschaft ist die in Hamburg 2024 um 1,7 Prozent gewachsen und lag im ersten Halbjahr 2025 noch um den Faktor zehn über dem Bundesschnitt. Das gibt doch durchaus Anlass zu Optimismus.
Optimismus ist aber auch eine Voraussetzung guten Unternehmertums. Unternehmen ist doch ein zukunftsgewandter Begriff. Und dabei ist die Stimmung weniger entscheidend als die wichtigsten zwei Felder, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Welche sind das?
Entbürokratisierung und ein europäisches Selbstbewusstsein, das Stärken und Werte, Freiheit und Demokratie offensiv nach außen vertritt. Beides gemeinsam bringt neue Zuversicht und Handlungsoptionen. Wenn – wovon ich ausgehe – die Welt, wie wir sie kennen, nicht zusammenbricht, entstehen auf dieser Grundlage unternehmerische Möglichkeiten. Seien sie technologie-, handels-, nachfragegetrieben, wie auch immer.
Also die Krise als Chance, wie Sie 2015 beim Zustrom syrischer Flüchtlinge äußerten?
Chancen in der Krise! Hamburgs wirtschaftliches Potenzial bleibt trotz der geopolitischen Gesamtlage, die natürlich Rückwirkungen auf ganz Deutschland hat, enorm. Zumal ich es nicht ausschließen würde, dass sich die Situation zwischen Trump und Putin, Protektionismus und Kriegen wieder einpendelt.
Die Vereinbarungen zwischen China und den USA zum Beispiel finde ich, vorsichtig formuliert, ermunternd. Außerdem haben wir in Europa, Großbritannien mitgezählt, immer noch den weltgrößten, hoch entwickelten Binnenmarkt. Um ihn optimal zu nutzen, ist aber noch etwas anderes vonnöten: ein neues Mindset.
Inwiefern?
Wir brauchen europaweit einen Aufbruch zu einer echten Transformations- und Leistungsgesellschaft, in der Arbeit und Fortschritt sowohl in der Bildung als auch im Beruf wieder ihren früheren Stellenwert erhalten. In der Wirtschaftswachstum wieder positiv belegt ist und als erstrebenswert gilt. In der derjenige zählt, der etwas schafft und beiträgt.
Darin ist uns Asien, insbesondere China, weit voraus. Nur wenn wir die Macht haben, mit dem Rest der Welt wirtschaftlich zu konkurrieren, können wir Demokratie und Freiheit verteidigen. Gerade Europas große Vielfalt ist dabei doch ein Quell der Träume, Kreativität, Visionen.
Neue Ideen entstehen nicht im Mainstream.
Bei 27 EU-Staaten mit ihren Einzelinteressen ist sie oft auch ein Hindernis.
Absolut, aber da sind wir doch wieder beim halb leeren Glas. Man kann Vielfalt als Komplikation oder Chance sehen. Ich plädiere für Letzteres. Neue Ideen entstehen nicht im Mainstream. Das dominierende Erfolgsmodell war jahrzehntelang der amerikanische Shareholder-Kapitalismus, in dem man zuvorderst versucht, reich zu werden.
Das europäische dagegen war eher ein Stakeholder-Kapitalismus, der über den Tellerrand kurzfristiger Gewinne aufs Ganze blickt. Mitbestimmung, Werteorientierung, Sozialverträge – auf so etwas sollte sich die EU bei aller Leistungsorientierung stärker besinnen. Soll ich Ihnen eine Anekdote erzählen?
Bitte!
Die British Chamber of Commerce hat mich 2007 eingeladen, über das europäische Wirtschaftsmodell zu sprechen. Kurz vor der Finanzkrise war der Applaus, nun ja, verhalten. Als ich zwei Jahre danach exakt denselben Vortrag mit meinem Credo „Europa führt!“ gehalten habe, war der Applaus fast frenetisch.

Schließlich hatte sich das deutsche Finanzsystem mit seiner dritten Säule starker Sparkassen und Volksbanken im weltweiten Vergleich als besonders stressresilient erwiesen. Das zeigt, wie wichtig feste Überzeugungen und ein solider Mittelstand sind. Auf beides sollten wir deshalb wieder stolz sein. Eine der Kernaufgaben von Politik und Zivilgesellschaft wäre es daher, Begeisterung für unsere Stärken und Werte zu kreieren.
Wie könnten diese Aufgaben besser wahrgenommen werden als bisher?
Zunächst mal durch bessere Vermittlungsstrategien. Die wirtschaftliche Kommunikation sollte sich nicht nur an ohnehin Überzeugte und Leser des „Manager Magazins“ oder Besucher von Fachkonferenzen richten – so gern ich dort selbst bin und diskutiere. Gemeinsam mit der Handelskammer könnten Unternehmen etwa Formate entwickeln, die sich auch an ganz gewöhnliche Menschen richten und idealerweise sogar solche erreichen, denen Europa bestenfalls egal ist und schlimmstenfalls zuwider.
Ich muss Menschen mögen, um sie zu führen.
Wir müssen versuchen, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Ansichten ins Gespräch zu bringen – auch wenn das manchmal schwerfällt. Kritisieren und Schlechtreden ist viel zu einfach, es geht darum, Begeisterung zu erzeugen.
Und wie zum Beispiel?
Wir könnten – mit der Handelskammer voran – ein hanseatisches „Best of European Business“ ausrufen und die Unternehmen prämieren und feiern, die in Europa besonders erfolgreich sind oder besonders gute europäische Ideen haben. Ein anderes Beispiel: Wir haben in der ZEIT-Stiftung eine Initiative namens „Zukunftswege Ost“ gestartet, die den demokratischen Dialog in den neuen Bundesländern vorantreiben soll. Wir fördern dort 33 Aktionen, Projekte und Organisationen, die das Miteinander, Demokratie und Gesellschaft stärken sollen. Um demokratiegefährdenden Tendenzen etwas entgegenzusetzen, muss sich unser politisches Denken und Reden verändern.
Können Sie das präzisieren?
Weniger abstraktes Fachvokabular, mehr praktische Alltagssprache und vor allem: mehr konkrete Problemlösung. Wie hält man den Hausarzt im Ort oder die Einkaufsfiliale? Wie erhält man ein Jugendzentrum?
Burkhard Schwenker, geboren 1958 in Minden, kam 1989 nach seiner Promotion in Mathematik und BWL zur Unternehmensberatung Roland Berger, die er von 2003 bis 2013 als CEO geleitet hat. Seit 2020 ist er dort als Senior Fellow tätig. Zudem sitzt er in einer Reihe von Bei- und Aufsichtsräten, darunter der M.M. Warburg & CO und der Flughafen Hamburg GmbH. Bei der Haspa firmiert er als Vorsitzender des Aufsichtsrates und leitet den Verwaltungsrat. Neben seiner Arbeit als Unternehmensberater widmet sich der 67-Jährige Wissenschaft und Forschung. An der „Leipzig Graduate School of Management“ lehrt er strategisches Management, ist Akademischer Co-Direktor des dortigen „Center for Scenario Planning“ und Mitglied im Hochschulrat der TU Bergakademie Freiberg. Als angesehener Buchautor schreibt Schwenker für internationale Medien über Strategie und Führung sowie über wirtschafts- oder industriepolitische Fragen. Als Vorsitzender des Kuratoriums der ZEIT-Stiftung, vom Aufsichtsrat der Symphoniker Hamburg oder der Stiftung Lebendige Stadt engagiert er sich außerdem gesellschaftspolitisch. Schwenker hat drei erwachsene Kinder und lebt in Hamburg.
Das sind Beispiele aus dem Osten, aber auch hier gilt: Gemeinsam ließe sich das, was man feiern darf, viel besser vermarkten. Als Stadtstaat haben wir den Vorteil der kurzen Wege. Alles liegt relativ eng beieinander.
Davon profitieren aktuell vor allem Bereiche wie Logistik, Finanzwirtschaft oder die IT-Branche. Was sagt das über den Standort aus?
Hamburgs Wirtschaftsstruktur besteht nur zu 17 Prozent aus industriellem Gewerbe. Immerhin, aber als Dienstleistungs- und Handelsmetropole sind Logistik und Finanzen automatisch zentrale Wirtschaftsfaktoren.
Und dank der urbanen Atmosphäre zieht sie junge Start-ups an, deren natürliches Habitat nun mal die IT ist. Ich hatte vor ein paar Jahren die Idee eines maritimen Digital-Clusters. Wir haben das neudeutsch „Digital Maritime Opportunities“ genannt.
Es hat sich zwar noch nicht durchgesetzt, aber in dieser Form der Kombination lokaler Stärken liegen ungeheure Zukunftspotenziale. Der Soziologe Richard Florida hat die Anziehungskraft attraktiver Metropolen wie Hamburg mit „Talente, Toleranz, Technologie“ beschrieben. Und für unsere große, vielfältige, internationale, ebenso liebens- wie lebenswerte Stadt gelten diese drei T doch ganz besonders. Darauf sollte sich Hamburg besinnen, das sollte es fördern.
Die Impossible Founders aus Langenhorn wurden ja im Juli für innovative Deep-Tech-Ausgründungen aus der Wissenschaft ausgezeichnet …
Und genau das zeigt ja den Weg: mehr Forschungskooperationen zwischen den Unis und den Unternehmen, mehr Offenheit der Hochschulen gegenüber Ideen aus dem Unternehmenssektor, mehr Kommunikation über das, woran die Institute gerade forschen. Neue Ideen brauchen immer eine Plattform! Auch hier würde ich Hamburg ein bisschen weniger hanseatisches Understatement wünschen und Preise wie diesen hier auch mal lautstark feiern. Mit etwas mehr Selbstbewusstsein und Euphorie kriegt man die strukturellen Probleme viel eher in den Griff.
Hamburg gilt als Deutschlands Start-up-Metropole. Bringt das auch ein neues Führungsdenken mit sich?
Ich glaube schon. Die Kernaufgabe von Führung besteht ja nicht mehr darin, Kommandos zu geben, sondern Orientierung. Klingt trivial, aber wenn prognostizierbare Zahlen in einer volatilen Wirtschaft an Bedeutung verlieren, werden solche Soft Skills auch auf Führungsebenen wichtiger.

Um das Wertegerüst eines Unternehmens zu vertreten, braucht gutes Führungspersonal demnach analytische, empathische, anpackende Persönlichkeiten. Ich muss Menschen mögen, um sie zu führen. Und auch dafür ist positives Denken unerlässlich. Mein zugehöriger Dreisatz lautet unabhängig von der Unternehmensgröße: cool head, warm heart, working hands.
Da fehlt decision, also Entscheidung.
Das ist für mich der kühle Kopf, der im Zweifel auch mal unpopuläre, gar harte Entscheidungen fällen muss. Aber wenn es ihm vorher gelungen ist, wertschätzende Orientierung zu geben, werden solche Entscheidungen leichter akzeptiert. Umso wichtiger ist es, dass sie einer Führungskraft gerade dann schwerfallen, wenn davon persönliche Schicksale betroffen sind.
Wie hat Sie in dieser Hinsicht Ihre Arbeit als CEO bei Roland Berger beeinflusst?
Maßgeblich. Vor allem in Hinsicht darauf, eine globale Community zu managen. Entschuldigung, ich übersetze mal selber: ein weltweit tätiges Gefüge von Büros in aller Welt zu organisieren. Deren kulturelle Vielfalt kennenzulernen, war eine der großen Bereicherungen meines Berufslebens, die man sich nicht anlesen kann, sondern erleben muss. Das hat mir dabei geholfen, immer den Menschen hinter den Zahlen zu sehen.
Spielt es dabei eine Rolle, dass Sie sich vom Hauptschüler zum Akademiker und Manager emporgearbeitet haben?
Ich glaube schon. Wobei meine Kindheit nicht immer einfach war, aber vergleichsweise kommod. Umso mehr hat sie mich gelehrt, wie wichtig in jeder Karriere das Glück ist, Menschen zu treffen, die einen auf dem Weg nach oben fördern.
Natürlich ist dieses Glück mit den Tüchtigen, aber ohne geht es nicht. Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber jede Führungskraft, egal ob sie von oben oder unten kommt, sollte sich stets vor Augen halten, dass an ihrer Arbeit Einzelschicksale hängen. Obwohl ich mitunter harte Entscheidungen zu Lasten anderer treffen musste, habe ich das nie vergessen.
In der Flüchtlingskrise haben Sie ja einen Afghanen bei sich aufgenommen. Aus reiner Menschenfreundlichkeit oder um der Gesellschaft etwas zurückzugeben?
Auch hier ist es eine Kombination, aber „zurückgeben“ klingt immer so großmütig. Und vor allem: Man bekommt ja auch etwas! Ali, so heißt der junge Mann, ist ein Teil unserer Familie geworden.

Ein großartiger Mensch. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Ohne wirkliche Schulbildung hat er es zum Polier geschafft und ist sicher noch nicht am Ende seiner Karriere. Wir haben also beide Glück gehabt, und das zeichnet auch meine Karriere aus.
Ich hatte bei aller Arbeit einfach viel Glück und als junger Mensch der Siebziger auch davon profitiert, dass sozialdemokratische Politik in Nordrhein-Westfalen und bundesweit Bildung für alle gefördert und mit dem BAföG wirklich Klassengrenzen überwunden hat. Sonst wären mir weiterführende Schulen schlicht verschlossen geblieben. Deshalb nutze ich, wo es mir möglich ist, meinen Einfluss, um auch für andere da zu sein.
Sie lehren strategisches Management mit Schwerpunkt Unternehmenstransformation. Wie würden Sie Hamburg transformieren?
Wir haben bislang vor allem über Hamburgs Stärken gesprochen, und da könnte ich noch viel mehr aufzählen. Durch meine Verbindung zu den Symphonikern fiele mir die exzellente Kulturförderung durch Carsten Brosdas Behörde ein. Oder dass Finanzsenator Andreas Dressel regelmäßig die „Stadtwirtschaft“, also kommunale Unternehmen, an einen Tisch bringt. So ein Forum kenne ich aus anderen Städten nicht. Aber Hamburg muss immer auch ein wenig aufpassen, sich nicht auf dem auszuruhen, was es hat.
Im Sinne von Berlins Motto „arm, aber sexy“?
Geniales Marketing! Aber kluge Slogans führen auch schnell mal zu einer Saturiertheit, in der man es sich allzu gemütlich einrichtet. Das gilt übrigens ebenso für Hamburgs Selbstverständnis als „Tor zur Welt“.
Viele Menschen hier schließen daraus, dass unsere Stadt auch weltbekannt ist. Da muss ich sie aus eigener Erfahrung leider enttäuschen (lacht). Man gefällt sich hier mitunter ein bisschen zu sehr selbst. Und Selbstgefälligkeit birgt für Standorte ebenso wie Unternehmen die Gefahr, es an Veränderungswillen und Eigeninitiative fehlen zu lassen.

Welche Branchen sind aus Ihrer Sicht denn gefeiter vor Selbstgefälligkeit?
Aus meiner Erfahrung im Aufsichtsrat des Hamburger Flughafens kann ich zum Beispiel den Luftfahrtcluster nennen. Große Unternehmen wie Airbus oder die Lufthansa-Werft bieten ideale Voraussetzungen für ein Biotop junger Start-ups. Und die Rückkehr der Überzeugung, dass Landesverteidigung von gesellschaftlich großer – und mit dem Sondervermögen exzellent finanzierter – Bedeutung ist, stärkt diesen Branchen gerade enorm den Rücken. Das kann, muss und wird sich Hamburg zunutze machen.
Nur in der Luftfahrt oder auch im Seehandel?
Auch dort. Die HHLA hat zum Beispiel ein eigenes Drohnen-Start-up gegründet. Und durch den erhöhten Bedarf der Marine werden womöglich sogar die Werften reanimiert. So bedrohlich die Weltlage gerade auch ist – für Hamburgs Wirtschaft sehe ich darin mehr Chancen als Risiken. Sofern die Entbürokratisierung weiter voranschreitet. Die ist ja nicht nur ein Hemmschuh für jede Art von Innovationsfähigkeit, sondern Ausdruck tiefen Misstrauens ins Verantwortungsbewusstsein ökonomischer Akteure.
Kluge Slogans führen auch schnell mal zu einer Saturiertheit, in der man es sich allzu gemütlich einrichtet.
Bürokratie sorgt aber auch für die Einhaltung notwendiger Standards, etwa beim Arbeitsrecht oder Klimaschutz.
Richtig. Aber es kommt aufs richtige Maß an und die Frage, wie bürokratisch und aufwendig Vorschriften umgesetzt werden. Wird die Umsetzung zu kompliziert, verlieren auch diejenigen, die Regelungen für richtig halten, ihre Motivation. Deswegen ist Vertrauen so wichtig – die allermeisten Unternehmen verhalten sich richtig, also „compliant“, und zwar aus Überzeugung! Und weil Hamburg als Stadtstaat den großen Vorteil hat, dass sich Unternehmen, Politik und Wissenschaft schon räumlich näher sind als in anderen Bundesländern, kann dieses Vertrauen leichter geschaffen werden. So könnte Hamburg auch mithilfe der Handelskammer wirklich zum deutschen Entbürokratisierungsmeister werden.
Eine schöne Antwort auf die Frage, wie Hamburg durchs Jahr 2026 kommt …
Das wäre für mich in der Tat eines der Zukunftsprojekte, mit denen sich punkten ließe: Hamburg als Vorzeigestadt für gelungene Entbürokratisierung zu machen! Das schaffte Attraktivität, Zuzug und Wachstumspotentiale! Vorausgesetzt, es wird mit viel Optimismus selbstbewusst kommuniziert.


