
Rund ein Jahr ist es her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz beim Halbleiterhersteller NXP Semiconductors im Innovationszentrum der DLR Quantencomputing-Initiative in Lokstedt den ersten vollständig in Deutschland entwickelten Quantencomputer symbolisch in Betrieb nahm. Quantencomputing, das ist eine der großen Zukunftsverheißungen, um mit schier unendlicher Rechenpower Probleme zu lösen und Berechnungen durchzuführen, die bislang kaum möglich schienen (siehe auch diesen Artikel).

Der öffentlichkeitswirksame Termin zeigte Hamburg so, wie sich die Stadt selbst gern sieht: als dynamische Wirtschafts- und Industriemetropole mit hoher Anziehungskraft für Start-ups, Forschung und Innovation. In einigen wichtigen Kennziffern liegt Hamburg allerdings deutlich hinter anderen Bundesländern zurück. So wurden 2024 zum Beispiel in Baden-Württemberg pro 100 000 Einwohner 137 Patente angemeldet, in Hamburg hingegen nur 23 (Bundesdurchschnitt: 47). In absoluten Zahlen: 15 494 Patente in Baden-Württemberg, 440 in Hamburg.
Auch bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung und der Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich „liegt die Hansestadt unter dem Durchschnitt, was erhebliche negative Auswirkungen auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Standortes hat“, konstatierte die Handelskammer bereits 2023 in ihrem Standpunkt „Zukunftstechnologien für Hamburg“. Zumindest ist Hamburg jetzt in die globalen Top 100 des international beachteten „Global Start-up Ecosystem Index“ aufgestiegen. Bislang war die Stadt dort nicht vertreten.
Clusterpolitik Hamburg setzt gezielt auf die Förderung von Clustern, also die Vernetzung von Akteuren, die sich ergänzen – etwa im Bereich Erneuerbare Energien oder Maritime Wirtschaft. Weshalb eine Neuausrichtung dieser Strategie erforderlich ist, zeigt eine Benchmarking-Studie, zu deren Auftraggebern die Handelskammer gehört.
Start-up-City Hamburg?
Das Thema „Start-ups“ spiegelt die Lage der Hansestadt recht deutlich. Mit derzeit rund 1600 Start-ups gehört sie zwar zu den wesentlichen Standorten in Deutschland, an denen neue, innovative Unternehmen entstehen. Im Vergleich zu Berlin und München ist sie jedoch deutlich abgeschlagen – und liegt aktuell hinter Potsdam auf Rang vier.
Die Stimmung der Start-ups an der Elbe wirkt zudem nicht überwältigend. Während die hiesige Zufriedenheit mit dem Start-up-Ökosystem unter Gründenden lediglich bei 46 Prozent liegt, erreicht sie bundesweit 61 und in München sogar 78 Prozent, konstatiert der „Hamburg Startup Monitor 2025“, den die Handelskammer in Kooperation mit dem „Startup Verband“ erstellt hat.
Als eines der zentralen Probleme identifiziert die jährliche Studie zum wiederholten Mal den mangelhaften Zugang zu Kapital in der Hansestadt. Während Berlin die unbestrittene Hauptstadt des deutschen „Venture Capitals“ ist, gelingt es in Hamburg deutlich schlechter, nach ersten Gründungsfinanzierungen an weiterführendes Wagniskapital zu kommen. Die Folge: Von den 27 deutschen Einhörnern, also Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, kommt mit 1KOMMA5° nur eines aus der Hansestadt.

„Die Frühfinanzierung von Start-ups funktioniert in Hamburg recht gut“, sagt Dr. Miriam Putz, Leiterin des Handelskammer-Bereiches „Innovation und neue Märkte“. „Bei späteren, größeren Runden, wenn es um Venture Capital geht, gibt es jedoch noch eine Lücke. Nur 13 Prozent der Hamburger Start-ups werden laut Umfrage mit Venture Capital versorgt, in Berlin sind es 31 Prozent.“ Dabei sind auch die investierten Summen weit geringer: Während Berliner Start-ups 2023 rund 2,4 Milliarden Euro einsammeln konnten, waren es in Hamburg nur 489 Millionen Euro, stellt ein neues Strategiepapier der Handelskammer fest (siehe auch diesen Artikel).
Hochschullandschaft als Stärke
Einer der zentralen Faktoren beim Aufbau einer Start-up-Szene und einer dynamischen Innovationskultur sind Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Und hier kann Hamburg punkten. „Wir haben die größte Hochschuldichte in ganz Deutschland“, sagt Dr. Florian Vogt, „und die Haltung der Hochschulen zu Technologietransfer und Kooperationen hat sich deutlich zum Positiven verändert.“ Vogt leitet die Innovations Kontakt Stelle (IKS) Hamburg, die seit 2011 der „One Stop Shop“ für Wissens- und Technologietransfer in Hamburg ist.
Und er ist von Anfang an dabei. „Da hat sich in fast 15 Jahren viel am Mindset verändert“, stellt er fest. Mit Großforschungseinrichtungen wie dem DESY und mehreren Fraunhofer-Instituten stehe Hamburg gut dar (siehe auch diesen Artikel). Wegweisend sei zum Beispiel die Kooperation der beiden Konzerne Jungheinrich und Still mit der Technischen Universität Hamburg (TUHH) bei der Entwicklung eines Standards für die industrielle Indoor-Lokalisierung, so der IKS-Leiter. Das gelte auch für die „Intelligent Sea Animal Detection“: Eine von Informatikern der Universität Hamburg entwickelte KI-Lösung, mit der sich zum Beispiel bedrohte Schweinswale über Luftaufnahmen 50-mal schneller identifizieren lassen.

Etwas weniger optimistisch fällt das Urteil von Axel Hoops aus: „Bei den Ausgründungen aus den Hochschulen ist Hamburg nicht unter den Top 10 in Deutschland“, sagt der Leiter der Handelskammer-Abteilung „Gründung, Förderung und Finanzmarkt“. Die Gründungsberatungen an den Universitäten würden zu selten in Anspruch genommen und müssten besser werden. Zugleich gebe es in der hiesigen Hochschulgesetzgebung noch viele bürokratische Hindernisse, die in anderen Bundesländern wie Bayern bereits abgeschafft seien. „Der Transfer von der Wissenschaft zur Wirtschaft muss noch besser werden.“
Webinare Wie können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit geringen Ressourcen erfolgreich innovieren? In einer Video-Reihe präsentiert die Handelskammer Lösungswege mit Praxisbeispielen aus Hamburger Betrieben. Die Bedeutung eines Innovationsmanagements wird ebenso erklärt wie die Rolle von Partnerschaften und Kooperationen. Mehr Infos erhalten Sie hier.
MINT-Ausrichtung fördern
Nach Ansicht vieler Fachleute beginnen die Hindernisse auf dem Weg zu mehr Innovations- und Gründergeist aber schon vor den Toren der Hochschulen und Start-up-Inkubatoren. Die meisten Start-ups und betrieblichen Innovationsprojekte verlangen Kompetenzen aus dem sogenannten MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. „Hamburg versucht hier schon viel und fördert einiges, es gibt tolle Initiativen“, sagt Dr. Julia Freudenberg. Die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hacker School hat sich zum Ziel gesetzt, „jedes Kind einmal programmieren zu lassen“.
Aber in Hamburg gebe es alleine 15 000 Siebtklässler, dafür reiche das Angebot nicht aus. „Dabei ist die Nachfrage riesig, die Schulen hängen enorm mit IT-Themen hinterher und sind überfordert“, konstatiert Freudenberg. „Wir brauchen zukunftsorientierte Menschen, die mit Technik umgehen können und in den MINT-Bereich wollen.“ Die Statistik zeigt: 30 Prozent der akademisch ausgebildeten Gründenden haben einen MINT-Abschluss. Gerade im Bereich DeepTech, wie er etwa rund um das DESY derzeit mit hoffnungsvollen Start-ups wie Class 5 oder LigandML heranwächst, ist dies eine zentrale Voraussetzung (siehe auch diesen Artikel).
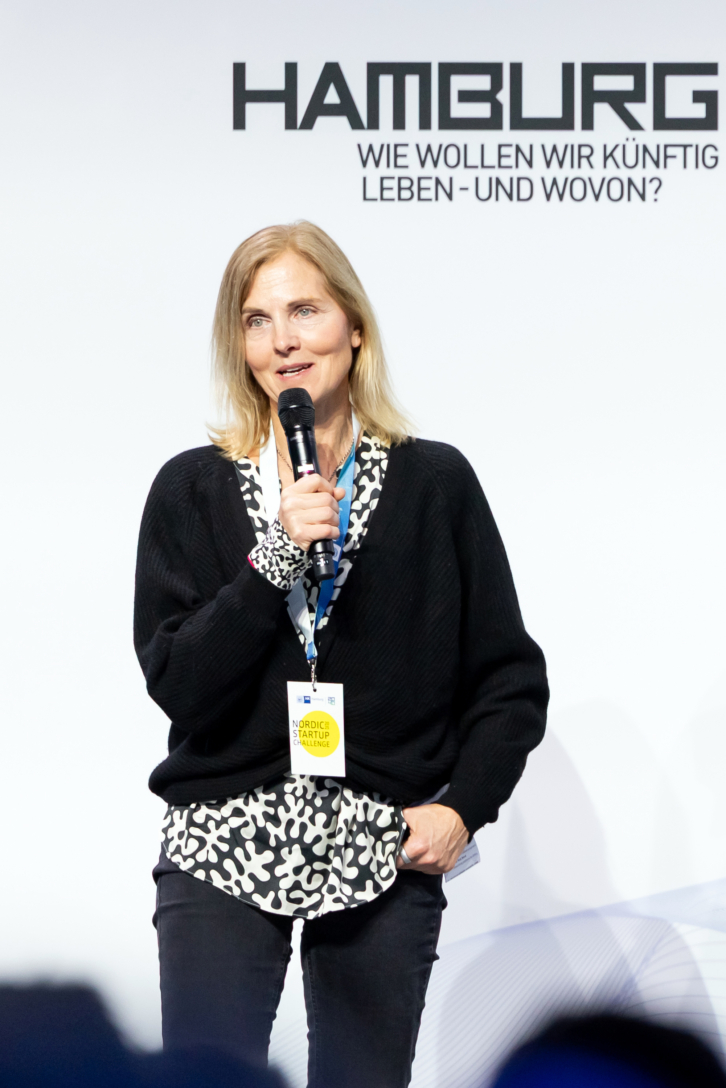
Der Ausbau der MINT-Fakultäten an den Hochschulen gehört deshalb auch zu den zentralen Forderungen des Standpunktpapiers „Zukunftstechnologien“ der Handelskammer. Auch andere Cluster, in denen Hamburg stark ist, werden zunehmend durch hoch spezialisierte Naturwissenschaft bestimmt. Etwa der Food-Sektor. Mit Bluu Seafood ist ein spannendes Start-up aus Lübeck nach Hamburg gekommen. Die Firma produziert Fisch im Labor.
Ein Hoffnungsträger angesichts der Aussicht, dass zur Mitte des Jahrhunderts die natürlichen Fischvorkommen in den Ozeanen ausgebeutet sein könnten. Und die 2018 gegründete Biotech-Firma Infinite Roots nutzt am Standort Hamburg Myzele, das wurzelähnliche Geflecht von Pilzen, um Lebensmittel ebenfalls im Labor herzustellen. Ziel ist nichts weniger als ein nachhaltigeres und gesünderes Lebensmittelsystem (siehe auch diesen Artikel).
Einrichtung einer Zukunftsstiftung
Um die Entwicklung solcher und anderer innovativer Ideen zur Marktreife besser als bislang zu unterstützen, fordert die Handelskammer Hamburg in ihrem Strategiepapier zu Innovationen die Einrichtung einer „Zukunftsstiftung“, die mit ihren Erträgen dort einspringt, wo Venture Capital fehlt und klassische Investoren zögern. Jeder investierte Euro der Stiftung soll dabei durch Co-Investments privater Kapitalgeber um ein Vielfaches gehebelt werden (siehe auch diesen Artikel).
Einen Turbo für mehr Dynamik sollen zudem Sonderinnovationszonen zünden. „Da müssen alle Stakeholder zusammenkommen und Wege frei machen, damit Ideen schnell und unbürokratisch getestet und umgesetzt werden können“, sagt Kathrin Haug, erfahrene Unternehmerin, Investorin und Leiterin des Handelskammer-Ausschusses für Technologie, Innovation und Digitalisierung.
Positionspapier Um die Zukunft zu sichern, muss Hamburg Innovationsschwerpunkte setzen, eine Zukunftsstiftung und Sonderinnovationszonen einrichten und den Fokus auf Internationalisierung setzen. So die Thesen eines gemeinsamen Papiers von Handelskammer, PIER PLUS und Landeshochschulkonferenz Hamburg von Ende 2024.
Mit dem Reallabor zu autonomer Mobilität habe Hamburg bereits gezeigt, wie so etwas funktionieren kann. Die Stadt müsse mehr solcher mutigen Entscheidungen treffen, denn der Handlungsdruck auf Hamburg und Europa insgesamt würde bekanntlich immer größer. Auf diesem Weg sollen dann noch mehr Leuchtturmprojekte wie der Hamburger Quantencomputer entstehen.
Ein Beispiel übrigens, das im vergangenen Jahr nicht nur für einen medienwirksamen Pressetermin gut war, sondern auch bereits ein weiteres spektakuläres Projekt nach sich gezogen hat. Dank einer Förderung der Investitions- und Förderbank Hamburg (IFB) wurde einem Konsortium aus DESY, DLR und diversen Start-ups ermöglicht, den Quantencomputer für die Entwicklung neuer Quanten-KI-Methoden zu nutzen.
Mit deren Hilfe sollen sich beispielsweise die immer komplexeren Daten des Large Hadron Collider (LHC) am CERN auswerten lassen. Die Abkürzung des Projektes, HQML, sollte man dabei in der Hansestadt mit einem gewissen Stolz zur Kenntnis nehmen, steht sie doch für „Hamburg Full Stack Quantum Machine Learning“.


