
„Hamburg ist ein globaler Dreh- und Angelpunkt für die Windenergiebranche“, erklärt Heiko M. Stutzinger, Chief Executive Officer der Hamburg Messe und Congress GmbH, die mit der „WindEnergy Hamburg“ alle zwei Jahre die globale Leitmesse für diesen Sektor ausrichtet. 2024 diskutierten dort mehr als 43 000 Teilnehmende aus rund 100 Nationen Zustand und Zukunft der Windenergie.
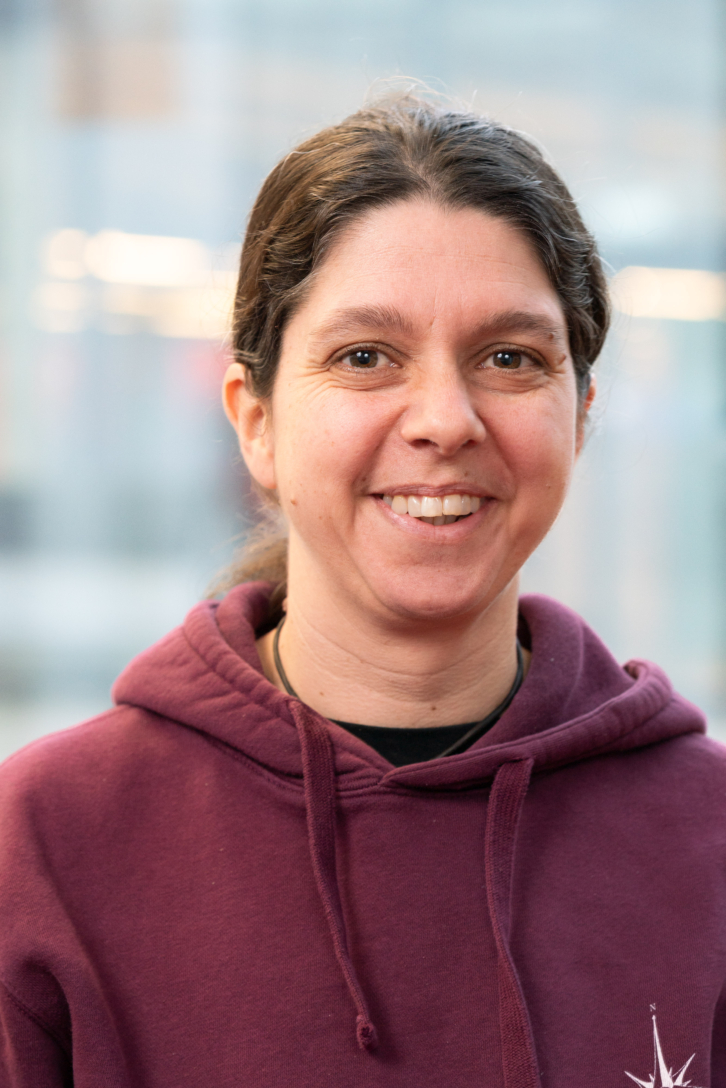
Neben der strategisch günstigen Lage punktet die Hansestadt vor allem mit Netzwerken wie dem Cluster „Erneuerbare Energien Hamburg“ (EEHH) und dem „Maritime Cluster Norddeutschland“ (MCN), die jeweils Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Akteure zusammenbringen.
Doch die in Hamburg ansässigen Branchengrößen wie Siemens Gamesa, Nordex und Vestas stehen auch vor Herausforderungen. „Zu den größten Hindernissen zählen hohe Investitionskosten, langwierige Genehmigungsverfahren, Fachkräftemangel, der schleppende Netzausbau und regulatorische Unsicherheiten“, erklärt Heiko M. Stutzinger mit Verweis auf den „WindEnergy trend:index“, den die „WindEnergy Hamburg“ halbjährlich mit dem Marktforschungsinstitut wind:research erstellt.
Dauerthema ist der schleppende Ausbau der Netze auf der Nord-Süd-Trasse. Denn nur bei stabilen Leitungsnetzen kann in Norddeutschland produzierte Windenergie kontinuierlich eingespeist und der Strom ohne Netzüberlastung verlässlich in den Süden des Landes transportiert werden. „Die Probleme bei der Infrastruktur sind zweifellos eine Bremse für die Energiewende und betreffen auch viele Hamburger Unternehmen.“
Stutzinger zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass Lösungen gefunden werden können, da der Druck auf die Entscheidungsträger stetig wachse. Gerade im Offshore-Bereich seien Akteure aus China, die stark in Forschung und Entwicklung investieren, ernst zu nehmende Konkurrenten. „Dieser Wettbewerb wirkt jedoch auch als Innovationsbooster für europäische Unternehmen.“
So entwickele etwa Siemens Gamesa in Hamburg hochmoderne Windkraftanlagen mit größerer Effizienz, längerer Lebensdauer und niedrigeren Betriebskosten. Zudem bietet die Digitalisierung mithilfe von KI große Wettbewerbsvorteile, etwa durch effizientere Windparks und weniger Ausfallzeiten.
Laut „Strom-Report“ hat Photovoltaik in Deutschland einen Anteil von 14,5 Prozent an der Stromerzeugung, gespeist aus 4,75 Millionen Anlagen, wobei 2024 knapp eine Million neu installiert wurden. Eine Studie des Clusters „Erneuerbare Energien Hamburg“ ergab, dass rund zwei Drittel des Strombedarfs der Stadt in Zukunft durch PV gedeckt werden könnten. Deren Verbreitung ist jedoch stark ausbaufähig: Im Vergleich der 20 größten Städte Deutschlands lag Hamburg im ersten Halbjahr 2024 auf dem drittletzten Platz (Analyse: Enpal). Die Plattform www.solarrechner-hamburg.de zeigt, welches Potenzial eine PV-Anlage auf dem eigenen Dach hat.
Bei der Solarenergie steht das Thema Photovoltaik (PV) im Fokus. Nach dem Hamburgischen Klimaschutzgesetz sind entsprechende Anlagen, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln, seit 2023 Pflicht bei Neubauten. Seit 2024 müssen sie bei einer Dachsanierung ebenfalls installiert werden.
Wie erfolgreich die Umsetzung ist, soll bis Mitte 2026 evaluiert werden. Die Umweltbehörde bewertet allerdings schon jetzt: „Der Ausbau von PV in Hamburg ist in Summe deutlich angestiegen in 2023 und 2024 im Vergleich zu den Jahren davor, auch auf Gewerbegebäuden, die teilweise große und geeignete Dachflächen aufweisen.“
Um die Umsetzung anzugehen, sind die von der Umweltbehörde geförderten „Hamburger Energielotsen“ oft die erste Anlaufstelle. „Momentan leisten wir viel Aufklärungsarbeit“, konstatiert Energielotsin Julia Marschall. „Welche Betreibermodelle sind sinnvoll?“ oder „Möchte ich den Strom selbst nutzen oder einspeisen?“, sind beispielsweise Fragen, die den Beratenden immer wieder gestellt werden.
Die Einstiegsorientierung sei vor allem für kleinere Firmen hilfreich, die sich kein eigenes Klimamanagement leisten können, so Marschall. Sie empfiehlt, die PV-Anlage nicht isoliert zu betrachten, sondern mit anderen Bereichen des Betriebes zu verbinden. Etwa einen Fuhrpark E-tauglich umzurüsten – für eine allumfassende Energiewende.


